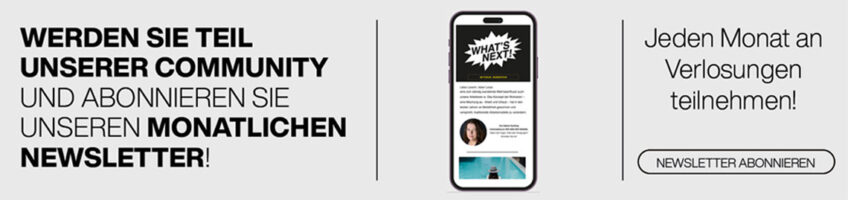Zunehmend stufen wir menschliche Emotionen und Verhaltensweisen als krankhaft ein, was Psychologe Marcus Roth kritisch sieht.
Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung betont Roth, die Gesellschaft neige zunehmend dazu, normale Lebenskrisen als psychische Störungen zu bewerten. Dadurch suchen immer mehr Menschen Therapien, obwohl sie keine echten psychischen Störungen haben, sondern nur vorübergehende Krisen erleben.
- Psychische Erkrankungen Hauptursache für Berufsunfähigkeit
- Steigende Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastungen
- Psychische Belastung massiv gestiegen
Roth zeigt sich besonders besorgt über die schwindende Akzeptanz emotionaler Grundreaktionen wie Trauer. “Früher galt der Verlust eines nahestehenden Menschen als Ausschlusskriterium für eine Depression”, erklärt er. Heute diagnostizieren wir bereits tiefe Traurigkeit, die länger als zwei Wochen anhält, als Depression. “Wir akzeptieren Trauer nicht mehr als normale Spielart des Seins. Dabei wird fast jeder einmal den Verlust naher Angehöriger erleben.” Roth kritisierte die Erwartung, das Leben müsse stets erfreulich sein und Unangenehmes sei “unnormal”.
Wenn psychische Erkrankungen inflationär werden
 Diese inflationäre Diagnosetendenz führt zu einem Mangel an Therapieplätzen für schwer Erkrankte, warnt der Psychologe. Patient:innen mit ernsten Problemen wie Depressionen oder Angststörungen warten in Deutschland oft bis zu 20 Wochen auf einen Therapieplatz – eine “nahezu unüberwindbare Hürde” für viele Betroffene.
Diese inflationäre Diagnosetendenz führt zu einem Mangel an Therapieplätzen für schwer Erkrankte, warnt der Psychologe. Patient:innen mit ernsten Problemen wie Depressionen oder Angststörungen warten in Deutschland oft bis zu 20 Wochen auf einen Therapieplatz – eine “nahezu unüberwindbare Hürde” für viele Betroffene.
Zwar kann Psychotherapie auch in Krisen ohne klare Erkrankung helfen, räumt Roth ein, doch sollte dies nicht die Solidargemeinschaft finanzieren. Oft genügen wenige Sitzungen oder der Austausch in Selbsthilfegruppen und Coachings. “Wenn es um Themen wie Stressmanagement oder Arbeitsorganisation geht, kann ein Coach genauso gut helfen”, so Roth. Für schwer erkrankte Menschen muss jedoch der Zugang zu umfassender Therapie gesichert bleiben. Roth befürchtet mittelfristig sogar Kürzungen im Bereich der Psychotherapie, was die Lage verschärfen würde. Er fordert daher eine offene Diskussion darüber, wo die Grenzen für die Notwendigkeit therapeutischer Unterstützung sinnvoll gezogen werden können.