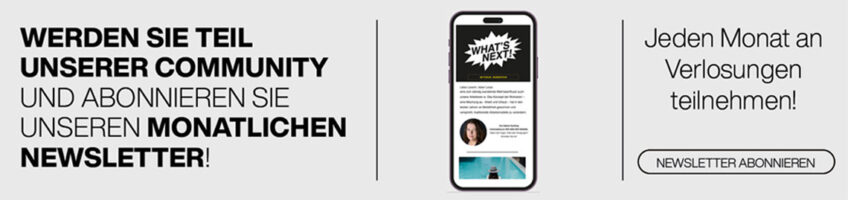Diversifizierte Teams treffen bessere Entscheidungen, lösen leichter Probleme, sind kreativer, innovativer und flexibler. Das ist Fakt, weil messbar. Diversity und Frauen in Führung sollten für Unternehmen daher auch unter knallharten wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden.
Demographische Faktoren sowie der Fachkräftemangel werden in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen. Entscheider sollten sich daher die Frage stellen: Ist mein Unternehmen unter dem Blickwinkel der Diversität reif für „echte Diversität“? Dabei sind die Vorteile von Vielfalt in Unternehmen unstrittig – was eine Vielzahl von Studien belegt: Diversifizierte Teams treffen bessere Entscheidungen, lösen leichter Probleme, sind kreativer, innovativer und flexibler. Das ist Fakt, weil messbar. Und weil Dominanz für diejenigen unsichtbar ist, die zur dominanten Gruppe gehören, für Außenstehende hingegen extrem sichtbar und spürbar, zeigen das Phänomen Trump sowie die Brexit-Abstimmungen, wie verheerend es sein kann, den Widerstand gegen Veränderungen zu unterschätzen oder kleinzureden.
Dass Vorurteile bei Entscheidungen immer wieder im Weg stehen, zeigen die sogenannten „Blind Auditions“, die Orchester bereits seit Jahrzehnten durchführen. Um die besten Musiker auszuwählen, spielen alle Bewerber hinter einem Vorhang, so dass die Auswahl aufgrund des Spiels – und nicht aufgrund von demografischen Eigenschaften – erfolgt. Und auch Algorithmen treffen mittlerweile oft bessere (Einstellungs-)Entscheidungen als Menschen. Denn Computerprogramme und Tools ermöglichen, Alter, Geschlecht, Bildungs- und sozioökonomische Hintergründe sowie andere Informationen aus dem Lebenslauf zu streichen – damit man sich ganz auf die fachliche Eignung konzentrieren kann.
Regeln, die die Autonomie beschneiden, sind kontraproduktiv
 Geht eine Unternehmensführung jedoch davon aus, dass es im Unternehmen fair und gerecht zugeht, wird sie die systembedingte Ungerechtigkeit gar nicht erst wahrnehmen. Dann werden Entscheidungen bezüglich Einstellung, Beförderung und Vergütung nicht einzig und allein aufgrund von Leistungen getroffen, dann erfolgen Beurteilungen nicht objektiv, dann wird Erfolg zur Glückssache. Wahrhaben wollen Entscheider das in der Regel nicht.
Geht eine Unternehmensführung jedoch davon aus, dass es im Unternehmen fair und gerecht zugeht, wird sie die systembedingte Ungerechtigkeit gar nicht erst wahrnehmen. Dann werden Entscheidungen bezüglich Einstellung, Beförderung und Vergütung nicht einzig und allein aufgrund von Leistungen getroffen, dann erfolgen Beurteilungen nicht objektiv, dann wird Erfolg zur Glückssache. Wahrhaben wollen Entscheider das in der Regel nicht.
Warum klammern sich Entscheider an die Vorstellung des fairen Umgangs? Weil sie sich ansonsten persönlich angegriffen fühlen, wenn sie infrage gestellt wird? Oder weil sie unfähig sind? Fakt ist: Entscheider sollten in der Lage sein, Ungerechtigkeiten in ihrem Unternehmen zu erkennen. Sie haben die Macht, mehr als jede andere Person im Unternehmen, Veränderungen herbeizuführen. Meist haben sie jedoch vergessen, welchen Einsatz sie selbst erbringen mussten, um ihre Position zu erreichen.
Eine weitere Hürde auf dem Weg zu mehr Vielfalt in Unternehmen sind die unterschiedlichen Definitionen. Laut einer Deloitte-Studie definieren die verschiedenen Generationen „Vielfalt“ unterschiedlich: Für Millennials beispielsweise ist Vielfalt und Inklusion eine wertschätzende, offene Beteiligung von Mitarbeitern mit verschiedenen Ansichten und Persönlichkeiten. Ältere Arbeitnehmer hingegen denken dabei an die gerechte Teilnahme und Integration von Menschen aus verschiedenen demografischen Gruppen. Weil jeder Mensch ein Gesamtpaket aus verschiedenen Eigenschaften ist, sind Mitarbeiter in einem Unternehmen wesentlich schwieriger zu analysieren und in Einklang zu bringen. Rhetorische Framing-Effekte – auch als „Schubladendenken“ bekannt – erschweren es zusätzlich.
Die Umgebung, in der Entscheidungen getroffen werden, verändern
Differieren Welt- und Menschenbild voneinander, treffen also unterschiedliche Wertvorstellungen und Glaubenssysteme aufeinander, sind interkulturelle Irritationen vorprogrammiert. Dabei sind interkulturelle Konflikte immer zwischenmenschliche Konflikte. Daher gehen viele instinktiv davon aus, dass Vielfalt zu zwischenmenschlichen Konflikten führt. Die Einstellungen von Menschen zum Positiven zu verändern, ist deshalb eine sehr große Herausforderung.
Damit sich Ansichten ändern, müssen sich zunächst die Erfahrungen von Menschen ändern. Von Vorbildern, sogenannten Role-Models, umgeben zu sein, die einem ähnlich sind, kann einen positiven Einfluss darauf haben, was man für sich selbst als möglich erachtet.
Der Verhaltensökonom Daniel Kahneman ist davon überzeugt, dass es vergebliche Liebesmüh ist, Vorurteilen auf individueller Ebene begegnen zu wollen – selbst mit entsprechenden Maßnahmen. Weil aber auf Unternehmensebene Denken und Handeln jedoch wesentlich langsamer ablaufen, gibt es hier eine Chance, die Entscheidungsfindung zu verbessern – obwohl es extrem schwierig ist, das menschliche Hirn neu zu verdrahten. Allerdings ist die Umgebung, in der Entscheidungen getroffen werden, zu verändern. Mit dem Ansatz der Entscheidungsarchitektur (Choice Architecture) werden Vorurteile abgeschwächt, statt sie umzukehren. Es geht also nicht darum, jemanden das Recht auf seine eigene Entscheidung zu nehmen oder ihm zu sagen, was er tun soll, sondern es ihm einfacher zu machen, rationalere Entscheidungen zu treffen.
- Generationenkonflikt in Unternehmen nur ein Mythos?
- Kulturelle Vielfalt: Führungskräfte sehen wenig Handlungsbedarf
- Deutschland wird vielfältiger
- Bundeswehr will vielfältiger werden
- Vielfalt wird für den Geschäftserfolg immer bedeutender
„Als Chancengleichheit bonusrelevant wurde, hat es bei dem Thema einen richtigen Push gegeben“
Bei dem Autobauer Porsche ist nach der Ära Wendelin Wiedeking – der nicht unbedingt für Frauen im Management stand – Diversity mittlerweile Pflicht. Das heißt, eine faire Beförderungspolitik ist bonusrelevant. „Wir wollen die Besten bei Porsche haben. Da wäre es fahrlässig, sich nicht verstärkt um die Frauen zu kümmern“, so Andreas Haffner, Personalvorstand der Porsche AG. Porsche verankerte daher 2012 das Thema Chancengleichheit fest in die Werte und Ziele des Unternehmens. Um dieses Ziel zu erreichen, erhielten die Mitarbeiter zwar ausreichend Spielraum, allerdings im Rahmen einer festen Quote für jeden Bereich. Und an der ist nicht zu rütteln. Halbjährlich wird Bilanz gezogen, am Ende des Jahres abgerechnet. „Als Chancengleichheit bonusrelevant wurde, hat es bei dem Thema einen richtigen Push gegeben“, so Konstanze Marinoff, Leiterin Personalmarketing der Porsche AG.
Umgesetzt wird das anhand eines kaskadenartigen Beförderungsmodells: Zunächst wird für jedes Ressort ermittelt, wie viele Frauen sich unter den leitenden Angestellten befinden. Dieser Anteil muss sich auch auf der Managementebene wiederfinden. In Bereichen mit mehr Frauen ist die Quote also höher als in denjenigen mit niedrigem Anteil. So will das Unternehmen verhindern, dass Frauen an der sogenannten gläsernen Decke scheitern und männliche Kollegen demotiviert sind.
Wer will sich schon zwischen Beruf und Familie komplett aufreiben
Weil eine Quote jedoch keinen Erfolg hat, wenn sich nicht parallel auch die Unternehmenskultur ändert, setzt der Konzern zusätzlich auf Fokusgruppengespräche, in denen herausgefunden werden soll, was es für eine Karriere bei Porsche braucht. Eine Unternehmens-Kita, Home-Office, sowie Führung in Teilzeit sollen für die nötige Flexibilität sorgen. Vor allem letzteres war für das Unternehmen ein großer Schritt. Früher bedeuteten nämlich Karrieren beim Autobauer: 120 Prozent Einsatz, lange Arbeitstage, Präsenz und ständige Erreichbarkeit – vor allem für Frauen mit Kindern extrem unattraktive Bedingungen. Die Folge: Weibliche Führungskräfte zeigten kein Interesse an einer Führungsposition. Wer will sich schon zwischen Beruf und Familie komplett aufreiben. Das Unternehmen war also gezwungen, Leistungsfunktionen in Teilzeit anzubieten. Und obwohl diese Maßnahmen erfolgreich sind, ist das Thema kein Selbstläufer. Daher muss regelmäßig mit Mitarbeitern über die Relevanz von Diversität diskutiert werden. Chancengleichheit ist also ein Prozess, der reifen muss, der permanente Dialog daher unerlässlich.
Welche Diversity-Maßnahmen funktionieren nicht?
Langfristig erfolgreiche Unternehmen benötigen Frauen und Männer, alte und junge Mitarbeiter, egal welcher Herkunft. Um das zu erreichen, setzen Entscheider auf verschiedene Maßnahmen. Allerdings sind nicht alle auch erfolgreich.
– Die Effekte von Diverstiy-Schulungen beispielsweise halten oft nicht länger als ein bis zwei Tage. Man kann Menschen zwar dazu bringen, in Fragebögen und Befragungen die richtigen Antworten zu geben. In der Praxis aber ist das schnell vergessen. Die Folge: Vorurteile werden aktiviert und Gegenreaktionen provoziert, da solche Schulungen vor allem negative Botschaften vermitteln. Freiwillige Maßnahmen sind deshalb grundsätzlich erfolgreicher. So nämlich haben Teilnehmer das Gefühl, selbst entscheiden zu können.
– Wer versucht, Vorurteile durch verpflichtende Einstellungstests zu entschärfen, erreicht genau das Gegenteil. Wer lässt sich schon gern sagen, dass er nicht einstellen kann, wen er will. Die Folge: Die Ergebnisse der Tests werden ignoriert, Vorurteile verstärkt, statt verringert.
– Ebenso zweifelhaft ist, ob mit jährlichen Leistungsbewertungen gerechte Vergütungs- und Beförderungsentscheidungen getroffen werden. Diverse Studien zeigen, dass Frauen und Angehörige von Minderheiten in Leistungsbewertungen entweder schlechter eingestuft werden oder Manager gleich allen gute Noten geben. Dem mit Beschwerdesystemen zu begegnen, funktioniert nur bedingt. Zwar dienen sie dazu, Manager mit Vorurteilen zu erkennen und sie auf den rechten Weg zu bringen. Allerdings wird entweder versucht, sich mit den Mitarbeitern, die die Beschwerde einreichen, zu arrangieren, oder diese mit Spott, Herabwürdigung, Mobbing etc. herabzusetzen. Die Folge: Es beschwert sich niemand, was Entscheider dazu verleitet davon auszugehen, dass Gerechtigkeit herrscht.
Strategien zur Bekämpfung von Vorurteilen funktionieren also nicht, denn man kann Menschen nicht motivieren mitzuziehen, indem man sie zwingt – und sie bestraft, wenn sie sich verweigern. Man kann Unternehmen allerdings so gestalten, dass es leichter fällt, das Richtige zu tun, wie „Blind Auditions“ oder das Beispiel Porsche zeigen.
Unternehmen, die Vielfalt leben, reden nicht, sondern handeln
Wenn all diese Maßnahmen nicht funktionieren, was können Entscheider stattdessen tun, um die Vielfalt in ihrem Unternehmen zu fördern? Zunächst muss sich der Vorstand zum Thema bekennen und klar den Auftrag geben. Denn Unternehmen, die Vielfalt leben, reden nicht, sondern handeln. Sie geben die Richtung klar vor und behandeln Gender-Fragen wie jede andere Unternehmensfrage auch. Sie nehmen sich selbst in die Pflicht und wälzen es nicht auf die Personalabteilung, die Frauen selbst oder Diversity-Beauftragte ab. Und sie sorgen dafür, dass jede Führungskraft motiviert ist, den Wert von Vielfalt zu vermitteln. Darüber hinaus sind alle internen Prozesse so gestaltet, dass sie unbewusste Vorurteile möglichst von vornherein ausschließen. Dazu gehört, Führungskräfte in die Lösung einzubeziehen, ihren Kontakt mit Frauen und Angehörigen von Minderheiten im Job zu intensivieren sowie an ihre soziale Verantwortung zu appellieren. Denn wer will schon im Unternehmen als ungerecht verschrien sein?
Stehen Ansichten und Verhalten nicht im Einklang, spricht man von „kognitiver Dissonanz“. Will man sie korrigieren und seine Ansichten oder sein Verhalten ändern, ist das mit positiven Botschaften und einer freiwilligen Beteiligung möglich. Dann verstehen sich Führungskräfte als Diversity-Botschafter, wie das Beispiel des Unternehmens Coca-Cola zeigt: Der Konzern motivierte nach der Anklage wegen Rassendiskriminierung seine Führungskräfte, sich in Rekrutierungs- und Mentoring-Initiativen zu engagieren. Diese Programme für Mitarbeiter und Führungskräfte im mittleren Management zielten speziell auf messbare Fortschritte bei der Einstellung und der Förderung von Minderheiten ab. Neben der Beteiligung des Topmanagements, wurde bei Neueinstellungen auf Talentscouts gesetzt. Die Folge: eine Positivspirale.
Die gemeinsame Arbeit bricht Vorurteile auf
Gerade der Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen kann Vorurteile abbauen. Selbstverwaltende Teams zum Beispiel ermöglichen Mitarbeitern, die in verschiedenen Rollen und Funktionen stecken, gleichberechtigt in einem Projekt zusammenzuarbeiten. Dabei bricht die gemeinsame Arbeit Vorurteile auf, was zu gerechteren Einstellungs- und Beförderungspraktiken führt. Und auch das Rotieren durch verschiedene Abteilungen (wie es bei Praktikanten üblich ist), ist eine weitere Möglichkeit, Kontakte zu intensivieren.
Die Förderung eines sozialen Verantwortungsgefühls begünstigt das menschliche Bedürfnis, vor Mitmenschen gut dazustehen. Allein die Vorstellung, ihre Entscheidung vor anderen rechtfertigen zu müssen, führt in der Regel dazu, dass die Leistung nach ihrer wirklichen Qualität bewertet wird. Und auch unternehmensinterne Diversity-Manager tragen zum stärkeren sozialen Verantwortungsgefühl bei, wie das Beispiel Deloitte zeigt: 1992 wollte der damalige CEO Mike Cook die Abwanderung weiblicher Mitarbeiter stoppen. Dafür stellte er eine Arbeitsgruppe aus hochrangigen Managern zusammen, bei der es aber nicht darum ging, das Fehlverhalten zu ächten. Um die Ergebnisse zu verbessern, wurde auf Transparenz gesetzt: Jedes Büro musste den Karrierefortschritt seiner Mitarbeiterinnen überwachen sowie sich Ziele zur Lösungen lokaler Probleme setzen. Als deutlich wurde, dass alle hochrangigen Manager den Prozess aufmerksam beobachteten, erhielten die Mitarbeiterinnen plötzlich den ihnen zustehenden Anteil an hochrangigen Kunden und Aufträgen. Ferner verstärkte diese Aufmerksamkeit das interne offizielle Mentoring. Das Ergebnis: Innerhalb von acht Jahren ging die Fluktuation auf das Niveau der männlichen Kollegen zurück.
Emotional aufgeladene Themen behutsam ansprechen
Allein die Tatsache, dass Entscheider oder Diversity-Manager Fragen stellen könnten, veranlasst Führungskräfte, alle qualifizierten Bewerber zu berücksichtigen und flexible Arbeitsmodelle wie beispielsweise das Job- bzw. Topsharing zu ermöglichen. Eine Maßnahme, die beim Leverkusener Werkstoffunternehmen Covestro sehr erfolgreich funktioniert. Dort nämlich ist das Topsharing eine Karriereoption für Frauen UND Männer. Dass diese Flexibilität gewünscht ist, zeigt eine internationale Umfrage von Bain & Company aus dem Jahr 2010: Demnach interessierten sich 78 Prozent der männlichen und 94 Prozent der weiblichen Führungskräfte für die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten.
Wie das Beispiel Porsche zeigt, braucht es für die berufliche Flexibilität eine Kulturveränderung im Unternehmen. Dazu zählen neben genügend Kita-Plätzen auch die Möglichkeit zum Home-Office sowie der permanente Dialog. Denn gerade emotional aufgeladene Themen müssen behutsam angesprochen werden. Das heißt, Botschaften sollten so formuliert sein, dass sie wirklich jeden erreichen. Daher unterstützen moderne Führungskräfte ihre Mitarbeiter, die Veränderungen als Chance und nicht als Bedrohung zu sehen. Dazu gehören auch Stellenanzeigen, die auf Formulierungen verzichten, die Männer oder Frauen unbewusst von einer Bewerbung abhalten.
Diversity und Frauen in Führung sollte auch unter knallharten wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden
Es gilt als gesichert, dass die herrschende Unternehmenskultur einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen und insbesondere von Veränderungsprozessen hat. Ebenso wird das Scheitern vieler Veränderungen häufig mit einer fehlenden Berücksichtigung der Kultur in Verbindung gebracht. Dennoch wird dies in der Praxis wenig beachtet.
Insbesondere, wenn Unternehmen neue Formen des Führens, Entscheidens und Zusammenarbeitens einführen möchten, stellt sich die Frage, wo die Qualifikation zum Startzeitpunkt kulturell steht und auf welche Stärken man gegebenenfalls bereits zurückgreifen kann.
Diversity und Frauen in Führung sollten für Unternehmen nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit sein, sondern auch unter knallharten wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden. Denn demographische Faktoren sowie der Fachkräftemangel werden in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen. Außerdem sind heute immer mehr Frauen hoch qualifiziert – häufig sogar besser als ihre männlichen Peers.
Messungen bewahren Unternehmen vor dem Blindflug
Entscheider sollten sich daher die Frage stellen: Ist mein Unternehmen unter dem Blickwinkel der Diversität reif für „echte Diversität“? Der „Diversity Culture Check“, entwickelt von Dr. Martina Nieswandt und Dr. Roland Geschwill von der Denkwerkstatt für Manager, hilft, diese Frage zu beantworten und anschließend die Maßnahmen zu ergreifen, die dann auch wirklich einen Nutzen bringen. Der von Nieswandt und Geschwill entwickelte „Lateral Culture Index“ (LCI®) ermöglicht es Unternehmen zu messen, wo sie mit ihrer Unternehmens- und Führungskultur stehen. So können Unternehmen weiterführende Ziele für ihre individuelle Kulturveränderung formulieren und Veränderungsprozesse entsprechend kulturell begleiten. Die Ergebnisse und deren Bedeutung werden anschließend in einem Gutachten dargelegt, mit dem Unternehmen diskutiert sowie Handlungsempfehlungen abgeleitet.
So wissen Entscheider genau, wo ihr Unternehmen hinsichtlich des Führens, Entscheidens und Zusammenarbeitens steht und können darauf basierend die weitere Vorgehensweise planen. Darüber hinaus bietet der LCI® die Möglichkeit, über den Zeitverlauf Veränderungen zu messen und damit die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen zu überprüfen.
Denn: „Was man nicht messen kann, kann man nicht managen”, sagte einst der Managementdenker Peter Drucker. Dennoch wird während Veränderungsprozessen selten eine Messung vorgenommen. So aber ist eine abschließende Erfolgsbewertung nur schwer möglich. Dabei bewahrt eine wissenschaftlich saubere Messung Unternehmen davor, in einem Blindflug unterwegs zu sein und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen oder zu verändern. Deshalb sollten Unternehmen dieselbe Konsequenz, die sie bei ihren Finanzentscheidungen und Marketingstrategien an den Tag legen, auch in der Personalführung walten lassen.
Weg von männlich dominierten Strukturen mit ihren Führungsstilen und Arbeitsweisen
Dabei ist die Messung nur ein Teil, denn die wichtige Arbeit kommt nach der Messung: Wie soll mit den Ergebnissen verfahren werden? Welche Schlüsse ziehen wir und welche Maßnahmen lassen wir folgen? Wie kommunizieren wir die Ergebnisse – insbesondere die schwierigen Ergebnisse?
Wer Vielfalt im Unternehmen erfolgreich umsetzen will, muss neben den sichtbaren Hürden wie Geschlecht oder Alter auch unsichtbare Herausforderungen wie gesellschaftlich verankerte Stereotypen im Blick haben sowie Rollenklischees infrage stellen. Um zukunftsfähig aufgestellt zu sein, muss also ein Umdenken stattfinden. Das heißt, weg von männlich dominierten Strukturen mit ihren Führungsstilen und Arbeitsweisen sowie klassischen Arbeitsmodellen, und hin zu mehr Flexibilität und Vielfalt. Denn der notwendige Wandel in Unternehmen betrifft alle Dimensionen der Diversität.